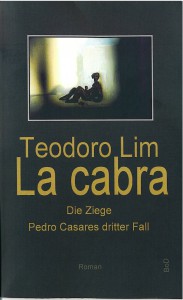.
 Der Film „Rudi Dutschke – sein jüngstes Porträt“ stammt aus dem Jahr 1968. Noch bevor der Film fertiggestellt war, ereignete sich das Attentat auf Rudi Dutschke. Am 11. April 1968 schoss der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf dem Kurfürstendamm in West-Berlin – vor dem Büro des „Sozialistischen Deutschen Stundenbundes“ (SDS) – auf Dutschke. Er traf ihn in den Kopf und in die Schulter.
Der Film „Rudi Dutschke – sein jüngstes Porträt“ stammt aus dem Jahr 1968. Noch bevor der Film fertiggestellt war, ereignete sich das Attentat auf Rudi Dutschke. Am 11. April 1968 schoss der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf dem Kurfürstendamm in West-Berlin – vor dem Büro des „Sozialistischen Deutschen Stundenbundes“ (SDS) – auf Dutschke. Er traf ihn in den Kopf und in die Schulter.
Rudi Dutschke erlitt lebensgefährliche Gehirnverletzungen. Bachmann wurde wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Elf Jahre nach dem Attentat – am 24. Dezember 1979 – starb Rudi Dutschke an den Spätfolgen der Verletzungen.
Die tiefe christliche Prägung Rudi Dutschkes und seine außergewöhnliche Persönlichkeit zeigten sich auch in dem Verhalten gegenüber dem Attentäter. Nach der Verurteilung Bachmanns nahm Rudi Dutschke Kontakt mit Josef Bachmann auf, um sich mit ihm zu versöhnen und ihn für ein sozialistisches Engagement zu gewinnen. Er besuchte Josef Bachmann im Gefängnis. Für den Attentäter brach damit eine Welt zusammen. Der Mensch und Christ Rudi Dutschke widersprach in jeder Hinsicht dem Feindbild, das Josef Bachmann im Kopf gehabt hatte, als er den Mordanschlag auf Rudi Dutschke verübte. Diese Einsicht trieb Josef Bachmann zur Verzweiflung – und war wohl mit verantwortlich für seinen Selbstmord am 24. Februar 1970. Nachdem Josef Bachmann sich im Gefängnis das Leben genommen hatte, bedauerte Dutschke, ihm nicht öfter geschrieben zu haben. Rudi Dutschke schrieb in sein Tagebuch: „[…] der Kampf für die Befreiung hat gerade erst begonnen; leider kann Bachmann daran nun nicht mehr teilnehmen […]“.
 Gedreht wurde der Film von Wolfgang Venohr, der 2005 verstorben ist (das Foto stammt vermutlich von Venohrs jüngerem Bruder Wolfram).
Gedreht wurde der Film von Wolfgang Venohr, der 2005 verstorben ist (das Foto stammt vermutlich von Venohrs jüngerem Bruder Wolfram).
Wolfgang Venohr atte einen besonderen Blick auf die deutsche Geschichte. Die Fragen, die er Rudi Dutschke in diesem Interview stellt, sind andere als sonst üblich – und lassen aufhorchen. Mir jedenfalls ging es so, als ich den Film zum ersten Mal sah.
Das tiefe Verständnis und die große Sympathie, die Wolfgang Venohr Rudi Dutschke entgegenbrachte, hing auch mit seinem eigenen Lebenslauf zusammen. Wolfgang Venohr wurde am 15. April 1925 in Berlin geboren. Mit sechzehn Jahren meldete er sich freiwillig zur Waffen-SS. Er hat dies nach 1945 nie verheimlicht – anders als manch anderer. Nach dem Krieg studierte Wolfgang Venohr an der FU Berlin Geschichte und Germanistik und wurde mit einer Arbeit über ein militärgeschichtliches Thema promoviert. Danach folgten Tätigkeiten als Volontär und Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, als Verkaufsleiter bei der UFA-Werbefilm und als Chefdramaturg bei der Fernsehgesellschaft der Berliner Tageszeitungen. Ab 1965 war er einige Jahre Chefredakteur von Stern TV. In seinem Büro hingen Porträts von Stauffenberg, Scharnhorst, Gneisenau – und Che Guevara.
Zwischen 1969 bis 1974 wurde Wolfgang Venohr einem breiten Publikum bekannt, weil er damals als einziger westdeutscher Journalist direkt aus der DDR berichten durfte.
Zentrale Themen Venohrs waren die Geschichte Preußens und der militärische Widerstand gegen Adolf Hitler. Er verfasste Bestseller wie, die Roten Preußen, Preußische Profile (zusammen mit Sebastian Haffner) und Fridericus Rex, Der Soldatenkönig, Ludendorff, Napoleon in Deutschland, Erinnerung an eine Jugend, Die Abwehrschlacht, Stauffenberg und weitere Sachbücher. 1982 brachte Venohr das Buch Die deutsche Einheit kommt bestimmt heraus, in dem er Autoren unterschiedlicher politischer Herkunft („von links bis rechts“) zusammenbrachte. Zu den Autoren gehörten u.a. Herbert Ammon und Peter Brandt. Das Buch wurde vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Bundestag mit Lob bedacht.
Der Historiker Peter Brandt würdigte Wolfgang Venohr in einem Nachruf als „eigenständigen Geist, dessen zugleich betont preußischer und schwarz-rot-goldener Nationalpatriotismus frei von besitzbürgerlicher Befangenheit und reaktionärem Spießertum war.“ Kann man Wolfgang Venohr mit wenigen Worten besser beschreiben?
Wir danken der Witwe Wolfgang Venohrs, Almute Venohr, die auch selbst anwesend war, für ihre Unterstützung. Ohne sie hätte dieser Filmabend nicht stattfinden können.

 Raed Saleh ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Seit April 2008 ist er Kreisvorsitzender der SPD Spandau und Mitglied im SPD-Landesvorstand. Er war Mitglied des Landesvorstandes der AG Migration und Mitglied des Kreisvorstandes der SPD Spandau. Raed Saleh arbeitete seit 2006 im Abgeordnetenhaus in den Ausschüssen für „Jugend, Bildung und Familie“, „Stadtentwicklung und Verkehr“ und „Integration, Arbeit und Soziales“ mit und war Ansprechpartner der SPD-Fraktion für die Bereiche „Soziale Stadt“ und Quartiersverfahren, sowie integrationspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Raed Saleh ist verheiratet, Vater zweier Söhne und Muslim.
Raed Saleh ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Seit April 2008 ist er Kreisvorsitzender der SPD Spandau und Mitglied im SPD-Landesvorstand. Er war Mitglied des Landesvorstandes der AG Migration und Mitglied des Kreisvorstandes der SPD Spandau. Raed Saleh arbeitete seit 2006 im Abgeordnetenhaus in den Ausschüssen für „Jugend, Bildung und Familie“, „Stadtentwicklung und Verkehr“ und „Integration, Arbeit und Soziales“ mit und war Ansprechpartner der SPD-Fraktion für die Bereiche „Soziale Stadt“ und Quartiersverfahren, sowie integrationspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Raed Saleh ist verheiratet, Vater zweier Söhne und Muslim. Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist. Er ist Direktor des Instituts für europäische Verfassungswissenschaften an der Universität Hagen und Sprecher des Historischen Promotionskollegs über „Gesellschaftliche Interessen und politische Willensbildung“. Er ist Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und u.a. Mitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Kuratoriums der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, des Beirats des Willy-Brandt-Archivs und der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand. Außerdem ist Peter Brandt Sprecher des Kuratoriums der Deutschen Gesellschaft, Gründungsmitglied des Kondylis–Instituts für Kulturanalyse und Alterationsforschung sowie Herausgeber des Online-Magazins Globkult (
Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist. Er ist Direktor des Instituts für europäische Verfassungswissenschaften an der Universität Hagen und Sprecher des Historischen Promotionskollegs über „Gesellschaftliche Interessen und politische Willensbildung“. Er ist Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und u.a. Mitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Kuratoriums der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, des Beirats des Willy-Brandt-Archivs und der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand. Außerdem ist Peter Brandt Sprecher des Kuratoriums der Deutschen Gesellschaft, Gründungsmitglied des Kondylis–Instituts für Kulturanalyse und Alterationsforschung sowie Herausgeber des Online-Magazins Globkult ( Zum Buch: Uwe Lehmann-Brauns ist Herausgeber eines Sammelbandes mit Beiträgen von über 30 Autoren. Dazu gehören die Historiker Heinrich August Winkler und Paul Nolte, die ehemaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen und Klaus Wowereit, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Justizsenator Thomas Heilmann und der ehemalige Kultursenator Thomas Flierl sowie Monika Grütters (CDU), Stefan Liebig (Die Linke) und Wolfgang Wieland (Bündnis 90/Die Grünen).
Zum Buch: Uwe Lehmann-Brauns ist Herausgeber eines Sammelbandes mit Beiträgen von über 30 Autoren. Dazu gehören die Historiker Heinrich August Winkler und Paul Nolte, die ehemaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen und Klaus Wowereit, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Justizsenator Thomas Heilmann und der ehemalige Kultursenator Thomas Flierl sowie Monika Grütters (CDU), Stefan Liebig (Die Linke) und Wolfgang Wieland (Bündnis 90/Die Grünen). Der Film „Rudi Dutschke – sein jüngstes Porträt“ stammt aus dem Jahr 1968. Noch bevor der Film fertiggestellt war, ereignete sich das Attentat auf Rudi Dutschke. Am 11. April 1968 schoss der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf dem Kurfürstendamm in West-Berlin – vor dem Büro des „Sozialistischen Deutschen Stundenbundes“ (SDS) – auf Dutschke. Er traf ihn in den Kopf und in die Schulter.
Der Film „Rudi Dutschke – sein jüngstes Porträt“ stammt aus dem Jahr 1968. Noch bevor der Film fertiggestellt war, ereignete sich das Attentat auf Rudi Dutschke. Am 11. April 1968 schoss der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf dem Kurfürstendamm in West-Berlin – vor dem Büro des „Sozialistischen Deutschen Stundenbundes“ (SDS) – auf Dutschke. Er traf ihn in den Kopf und in die Schulter. Gedreht wurde der Film von Wolfgang Venohr, der 2005 verstorben ist (das Foto stammt vermutlich von Venohrs jüngerem Bruder Wolfram).
Gedreht wurde der Film von Wolfgang Venohr, der 2005 verstorben ist (das Foto stammt vermutlich von Venohrs jüngerem Bruder Wolfram).
 „Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit fand sich während der politischen Unruhen der 1960er Jahre innerhalb der politischen Rechten eine Gruppe junger Aktivisten zusammen, die sich scharf vom Nationalsozialismus abgrenzte: Die sogenannten „Nationalrevolutionäre“. Progressiv, europäisch, revolutionär, intellektuell und subversiv gaben sich die jungen Rechten, die gemeinsam mit den jungen Linken die Revolution gegen die ältere Generation herbeiführen wollten.“ (Zitat)
„Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit fand sich während der politischen Unruhen der 1960er Jahre innerhalb der politischen Rechten eine Gruppe junger Aktivisten zusammen, die sich scharf vom Nationalsozialismus abgrenzte: Die sogenannten „Nationalrevolutionäre“. Progressiv, europäisch, revolutionär, intellektuell und subversiv gaben sich die jungen Rechten, die gemeinsam mit den jungen Linken die Revolution gegen die ältere Generation herbeiführen wollten.“ (Zitat) Das Zitat stammt aus dem Klappentext des Buches „LINKE LEUTE VON RECHTS?“, das von Benedikt Sepp im Tectum-Verlag veröffentlicht wurde. Benedikt Sepp hat sich mit Faschismus und politischem Extremismus in der Bundesrepublik sowie mit Kulturtheorien auseinandergesetzt. Er promoviert z.Zt. an der Universität Konstanz – im Rahmen des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ – über linke Theorien in der Studentenbewegung.
Das Zitat stammt aus dem Klappentext des Buches „LINKE LEUTE VON RECHTS?“, das von Benedikt Sepp im Tectum-Verlag veröffentlicht wurde. Benedikt Sepp hat sich mit Faschismus und politischem Extremismus in der Bundesrepublik sowie mit Kulturtheorien auseinandergesetzt. Er promoviert z.Zt. an der Universität Konstanz – im Rahmen des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ – über linke Theorien in der Studentenbewegung. Kurt Schilde hat vor allem über den Nationalsozialismus und die dazu entwickelte Erinnerungskultur geforscht. Von 1987 bis 1990 war er in Tempelhof wissenschaftlicher Mitarbeiter des Heimatmuseums. Er hat in dieser Zeit u.a. ein Gedenkbuch für die aus Tempelhof stammenden Opfer des Nationalsozialismus erstellt.
Kurt Schilde hat vor allem über den Nationalsozialismus und die dazu entwickelte Erinnerungskultur geforscht. Von 1987 bis 1990 war er in Tempelhof wissenschaftlicher Mitarbeiter des Heimatmuseums. Er hat in dieser Zeit u.a. ein Gedenkbuch für die aus Tempelhof stammenden Opfer des Nationalsozialismus erstellt.