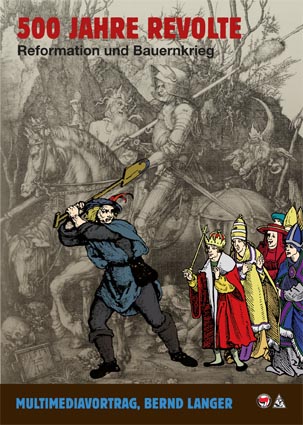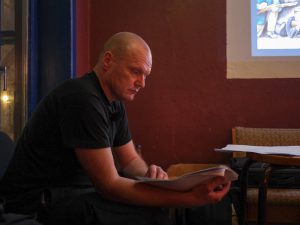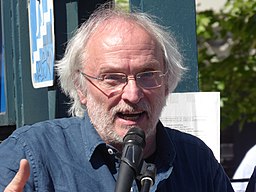Einlass 30 Minuten vorher
Moderation: Roland Wehl
Harald Martenstein hat ein Buch über seine erste Liebe geschrieben: das Kino.
Als Kritiker, Kulturreporter und Humorist schreibt Harald Martenstein (* 9. September 1953 in Mainz) seit seinen Anfängen immer wieder über Filme, Festivals und das Filmbusiness, über die großen Stars und ihre kleinen Missgeschicke. Seine tägliche Kolumne während der Berlinale genießt bei Lesern und Radiohörern Kultstatus.
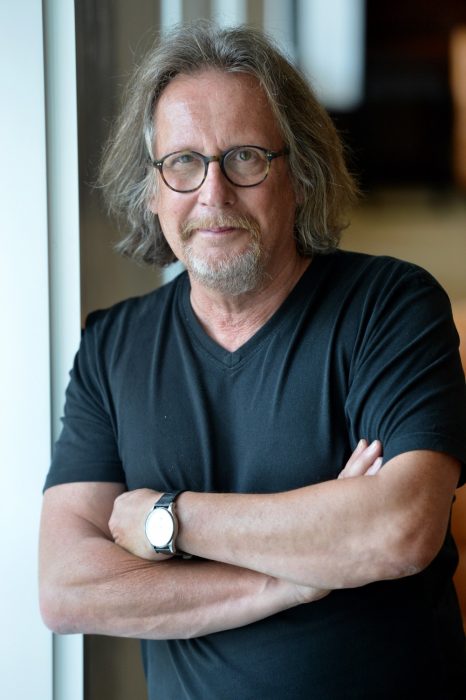 Harald Martenstein arbeitete nach dem Abitur am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz einige Monate in einem Kibbuz in Israel und studierte dann Geschichte und Romanistik in Freiburg.
Harald Martenstein arbeitete nach dem Abitur am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz einige Monate in einem Kibbuz in Israel und studierte dann Geschichte und Romanistik in Freiburg.
In den 70er Jahren war er für einige Zeit Mitglied der DKP. Von 1981 bis 1988 war er Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und von 1988 bis 1997 Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin. Dann übernahm Martenstein für kurze Zeit die Leitung der Kulturredaktion bei der Abendzeitung in München, kehrte jedoch wenig später als leitender Redakteur zum Tagesspiegel zurück.
Seit 2002 schreibt Harald Martenstein eine Kolumne für die ebenfalls zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck gehörende DIE ZEIT, zunächst unter dem Titel Lebenszeichen und seit dem 24. Mai 2007 im Rahmen des ZEIT-Magazins LEBEN. In überarbeiteter Form erschien eine Auswahl dieser satirischen Causerien erstmals 2004 in dem Sammelband Vom Leben gezeichnet. Einige Jahre war Martenstein zudem mit Kolumnen in der GEO kompakt vertreten. Martenstein schreibt derzeit für jede Sonntagsausgabe des Tagesspiegels eine Kolumne (link), darüber hinaus auch regelmäßig Glossen zu den Berliner Filmfestspielen und vereinzelt auch größere Reportagen und Essays.
2004 erhielt Harald Martenstein den Egon-Erwin-Kisch-Preis für einen Text über die Erb- und Führungsstreitigkeiten im Frankfurter Suhrkamp Verlag. Dieser wurde mangels Kooperationswillens der Verlagschefin auch eine Reportage über investigativen Kultur-Journalismus. Im Februar 2007 erschien Martensteins Roman (link)Heimweg, in dem er eine deutsche Familienchronik der Nachkriegszeit schildert und für den er im selben Jahr mit dem Corine-Debütpreis ausgezeichnet wurde. Außerdem erscheinen regelmäßig Bände mit gesammelten ZEIT-Kolumnen. Anfang 2007 bis Ende 2008 war auf watchberlin.de alle zwei Wochen eine Video-Kolumne mit dem Titel Martenstein! zu sehen. Im Gegensatz zu seinen ZEIT-Kolumnen bezogen sich die Themen dieser in Martensteins Kreuzberger Küche aufgezeichneten Beiträge oft speziell auf Politik und Kultur in Berlin. Gemeinsam mit dem Kolumnisten Rainer Erlinger (Süddeutsche Zeitung) trat Martenstein 2008 und 2009 regelmäßig im Berliner Deutschen Theater auf. In ihrer Moral-Show diskutieren Martenstein und Erlinger moralische Alltagsfragen und stellen sie dem Publikum zur Abstimmung. Journalistisches Handwerk, vor allem zur Textsorte Kolumne, vermittelt Martenstein seit 2006 regelmäßig an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel und an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg.
Seit Herbst 2007 hat Harald Martenstein auf radioeins eine eigene Radiokolumne (link). Der NDR (link)schloss sich 2013 an. Dieter Nuhr lud ihn im September 2014 zu einem Auftritt in der ARD-Kabarettsendung Nuhr im Ersten ein.
In unseren Veranstaltungen geht es auch dann musikalisch zu, wenn es sich nicht um ein Konzert handelt. Dann singen wir zu Beginn ein Lied, das der Gast bzw. Referent ausgesucht hat. Am Ende wird das Buffet eröffnet.

 Ein Komponisten-Gigant wie Johann Sebastian Bach verträgt viel. Auch an Fragen. So fahndet Hanno Botsch, der musikaffine, in Freiburg und Karlsruhe lebende Mediziner, auf dieser CD nach Spiegelungen des Kindlichen in Bachs Tonkunst. Das meint hier beispielsweise die Freude an Bewegung und Motorik, auch Ungeduld oder gar Übermut. Just von der klaren, feinsinnigen Polyphonie einer munteren Bach’schen Fuge fühlt sich Botsch indes ans Gewirr auf einem Schulhof erinnert. Da kommt einem eher die Gattin jenes namhaften Musikologen in den Sinn, die mit Bach die Ordnung in den Schubladen ihres Haushalts assoziierte. Bachs Musik kann humorvoll und traurig sein. Sie lässt sich obendrein jazzig nutzen (was ja keineswegs neu ist).
Ein Komponisten-Gigant wie Johann Sebastian Bach verträgt viel. Auch an Fragen. So fahndet Hanno Botsch, der musikaffine, in Freiburg und Karlsruhe lebende Mediziner, auf dieser CD nach Spiegelungen des Kindlichen in Bachs Tonkunst. Das meint hier beispielsweise die Freude an Bewegung und Motorik, auch Ungeduld oder gar Übermut. Just von der klaren, feinsinnigen Polyphonie einer munteren Bach’schen Fuge fühlt sich Botsch indes ans Gewirr auf einem Schulhof erinnert. Da kommt einem eher die Gattin jenes namhaften Musikologen in den Sinn, die mit Bach die Ordnung in den Schubladen ihres Haushalts assoziierte. Bachs Musik kann humorvoll und traurig sein. Sie lässt sich obendrein jazzig nutzen (was ja keineswegs neu ist).